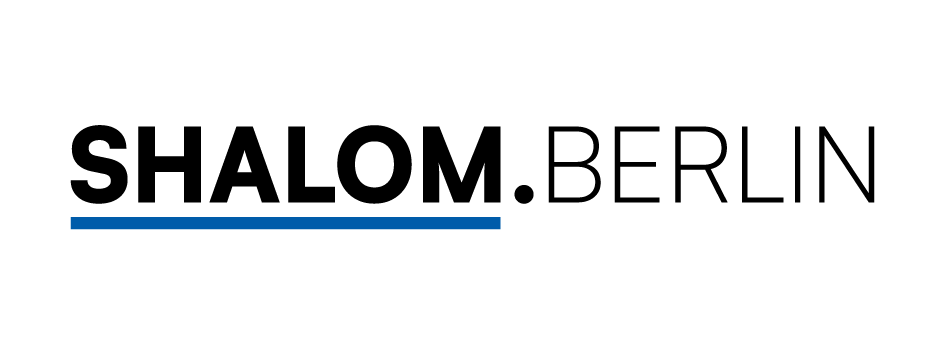How our Wikipedia entry could look like
We’ve been thinking: how would SHALOM.BERLIN sound if someone looked at it from the outside, through the sober, neutral lens of an encyclopedia?
No tone, no wink, no edge — just facts.
Wir haben uns gefragt: Wie würde SHALOM.BERLIN wohl klingen, wenn jemand von außen darauf blickt – durch die nüchterne, sachliche Linse einer Enzyklopädie?
Ohne Zwinkern, ohne Haltung, einfach nur Fakten.
So könnte das aussehen:
Infobox Unternehmen
Name = SHALOM.BERLIN
Unternehmensform = Einzelunternehmen
Gründungsdatum = 2025
Sitz = Berlin
Branche = Mode / Streetwear
Website = https://www.shalom.berlin
''SHALOM.BERLIN'' ist eine Berliner Modemarke, die 2025 ins Leben gerufen wurde und deren Gestaltungsprinzip auf deutschen Wörtern jüdischen Ursprungs basiert. {Internetquelle https://www.shalom.berlin/about
Die Wortmotive werden jeweils um knappe, ironische oder lakonische Zusätze in englischer Sprache ergänzt, teils mit direktem Bezug zu Berlin. Charakteristisch ist die typografische Trennung: Die Hauptbegriffe erscheinen in einer pseudo-hebräisierten Schrift, während die Ergänzungen in einem modernen, zeitlosen Font gesetzt sind. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über den Online-Shop der Marke. {Internetquelle https://www.shalom.berlin/shop
Konzept
Das Konzept von SHALOM.BERLIN besteht darin, die Selbstverständlichkeit jüdischer Einflüsse in der deutschen Sprache sichtbar zu machen.
Hierfür kombiniert die Marke alltagsbekannte Lehnwörter mit kurzen, kommentierenden Zusätzen.
Die Gestaltung ist bewusst reduziert: klare Typografie, prägnante Formulierungen und eine kontrastierende Schriftwahl – pseudo-hebräisiert für den Hauptbegriff, modern-sachlich für die jeweilige Ergänzung.
Durch den Einsatz englischer Sprache werden auch internationale Interessenten angesprochen.
Im theoretischen Hintergrund bezieht sich SHALOM.BERLIN ausdrücklich auf die wissenschaftliche Literatur zur jiddischen Wortgeschichte, wie sie etwa von Hans Peter Althaus oder anderen Linguisten beschrieben wurde. Diese Arbeiten thematisieren den Einfluss jiddischer Lehnwörter auf die deutsche Alltagssprache und bilden einen sprachgeschichtlichen Bezugspunkt für das Markenprinzip.
Produkte
Zum Sortiment zählen T-Shirts, ein Sweatshirt, Caps und eine Bomberjacke.
Zentrales Motiv und zugleich Ausdruck der Markenphilosophie ist die Dualität zwischen den Shirts „don’t be a SCHMOCK“ und „be a MENSCH“, ergänzt durch passende Caps mit den Stickereien „no SCHMOCK“ und „be a MENSCH“.
Darüber hinaus umfasst das Sortiment Shirts mit Begriffen wie ''Massel'', ''Schlamassel'', ''Meschugge'', ''Gauner'', ''Schickse'', ''Malocher'', ''Pleite'' oder ''Bubbele'', jeweils mit kurzen, humorvollen bzw. lakonischen Ergänzungen.
Die gesamte Produktpalette wird auf der Website der Marke vorgestellt und über den Shop vertrieben.
Gestaltung und Stil
Die visuelle Sprache von SHALOM.BERLIN ist minimalistisch und typografisch fokussiert.
Die Kombination aus pseudo-hebräisierter Darstellung der Hauptbegriffe und nüchterner, zeitloser Zweitschrift für die englischsprachigen Zusätze bildet das zentrale Gestaltungselement.
Kampagne
Unter dem Titel „Legends wearing shirts they never asked for“ präsentiert SHALOM.BERLIN eine Reihe von KI-generierten Motiven, auf denen historische oder ikonische Figuren die Kleidungsstücke der Marke tragen.
Die Kampagne ist auf der Website abrufbar. {Internetquelle https://www.shalom.berlin/legends-with-good-taste
Sie spielt mit der Idee, dass Sprache, Humor und Haltung kulturelle und zeitliche Grenzen überschreiten.
Kommunikation
SHALOM.BERLIN kommuniziert primär über die eigene Website sowie über soziale Medien, insbesondere [https://www.instagram.com/shalom.berlin/
Dort werden neue Produkte, Kampagnen und Bildserien vorgestellt.
In Berlin-Mitte bewerben zudem Einzelhändler das Produktsortiment der Marke mit Plakaten.
Weblinks
https://www.shalom.berlin/ Offizielle Website
https://www.shalom.berlin/lookbook Lookbook
https://www.instagram.com/shalom.berlin/ Instagram-Profil
SORTIERUNG:Shalom.Berlin
Kategorie:Modemarke
Kategorie:Streetwear
Kategorie:Modeunternehmen (Berlin
Kategorie:Deutsche Sprache – Lehnwörter